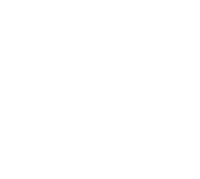Sherlock Holmes hört auf!?
09/07/2022TOPP durch die Adventszeit gerätselt!
01/11/2022Ein Nachruf auf Königin Elizabeth II. aus gegebenem Anlass.
von Patrick Charell

Am 8. September 2022 schloss Elizabeth Alexandra Mary Windsor, Königin von Großbritannien und Nordirland, Staatsoberhaupt von 32 Ländern, Verteidigerin der Anglikanischen Kirche, auf Schloss Balmoral die Augen und starb. 70 Jahre und 214 Tage saß Queen Elizabeth II. auf dem Thron, ein Rekord im Vereinigten Königreich. Wenige Wochen zuvor hatte die Nation ihr Platin-Jubiläum gefeiert.
Gerade für die besonders anglophile Deutsche Sherlock-Holmes-Gesellschaft ist es ein Moment, um innezuhalten. Denn sehr vieles ist in den letzten Jahren geschehen, was unsere besondere Beziehung zur britischen Kultur, das Gefühl von intimer Vertrautheit und Bewunderung erschüttert hat. Der Tod der Königin scheint da nur ein Fanal zu sein.
Denn in Elizabeth II. verbanden sich – gemäß der mittelalterlichen Zweikörperlehre – das menschliche und das institutionelle Wesen der Monarchie zu einem machtvollen Bild, dass eine ganze Ära prägte. Nur zwei weiteren englischen Herrschern, beides Frauen, gelang etwas Vergleichbares: Elizabeth I. hatte ihr Land in die Neuzeit geführt und die Welt für England geöffnet. Viktoria hingegen begleitete durch ihre schiere Langlebigkeit eine der innovativsten Epochen der Menschheitsgeschichte und repräsentierte das britische Empire in seiner Blütezeit.
Als Elisabeth im Jahr 1926 geboren wurde, bedeckte dieses Weltreich mehr als 35 Millionen Quadratkilometer und bestimmte das Schicksal von 23 % der gesamten Menschheit. Dennoch trug es bereits den Keim des Untergangs in sich: Noch vor Elizabeths Krönung am 2. Juni 1953 hatten sich Irland, Kanada, Australien und Neuseeland von Großbritannien losgesagt, der indische Subkontinent war verloren und in rivalisierende Nationen zerbrochen. In den ersten beiden Jahrzehnten ihrer Herrschaft musste Elisabeth II. den Rest des Empires abwickeln. Die Rückgabe Hong Kongs an die Volksrepublik China läutete 1997 eine post-britische Weltordnung ein. Das „Commonwealth of Nations“, dieser lose Verbund ehemaliger Kolonialvölker, funktionierte bislang vor allem durch die starke Persönlichkeit der Queen. Bereits in den späten 1950er Jahren legte sie großen Wert auf die Gleichwertigkeit aller Kulturen und saß mit farbigen Politikern öffentlich an einem Tisch – damals keine Selbstverständlichkeit. Ausgerechnet ihr Rassismus vorzuwerfen, ist daher besonders infam.
Elisabeth II. war daher in erster Linie die Königin einer umfassenden sozialen und wirtschaftlichen Transformation. Ihre Krönungszeremonie gilt als mediale Sensation, auch weil erstmals das Fernsehen live dabei war. Fast hätte es die berühmte Übertragung gar nicht gegeben: Erzbischof Geoffrey Fisher von Canterbury, der die Zeremonie leitete, nannte diese „massenproduzierte Form der Unterhaltung eine der größten Gefahren für die Welt“. Aber der Druck aus der Bevölkerung war zu groß, und so lenkten Hof und Kirche am Ende ein. Dieser Schritt war bahnbrechend: Unter Elizabeth II. entwickelte sich „the Firm“, wie sie die Königliche Familie später mit einer gehörigen Portion Selbstironie nannte, zu einem professionellem Medienunternehmen. Heute ist das Königshaus auf allen sozialen Medien und mit einer eigenen Webseite präsent, es vertreibt Produktlinien und verkauft Lizenzen.
Als die Königin im Jahr 1965 mit Prinzgemahl Phillip die Bundesrepublik besuchte, ganze elf Tage lang, war es für die Deutschen ein wichtiger Schritt hin zur Versöhnung. Was nur wenige wissen: Dieser Besuch ging vor allem vom deutschstämmigen Haus Mountbatton-Windsor aus (eigentlich Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg-Sachsen-Coburg-Gotha), nicht von den politischen Entscheidern in der Downing Street.
In den 1960er und 1970er-Jahren stand das Label „Made in Britain“ für Qualität und Eleganz, Weltläufigkeit und Coolness. Die Carnaby Street in London war das Mekka der Modewelt. Mary Quants Minirock, die Beatles, die Rolling Stones, Freddy Mercury, James Bond-Filme, Vintage-Schick und Monthy Python sind einige Schlagwörter aus dieser bunten Zeit. Auch dafür steht das Gesicht der Königin, das nun endgültig zu einer Pop-Ikone wurde, von Andy Warhol in Szene gesetzt, auf unzähligen Souvenirs und Talmi abgedruckt. Die Queen blieb für drei Generationen ein Fels in der Brandung. Etwas respektlos formuliert: Sie war wie ein altes Möbelstück, das immer schon zur Familie gehörte und daher alle nostalgische Sentimentalität auf sich vereinte.
Ab 1971 ersetzte das (napoleonische!) Dezimalsystem die althergebrachten Rechenfüße des Landes. Halfpennies und Shilling, Crown und Farthings verschwanden zugunsten neuer Geldscheine und Münzen, die jedoch wie gehabt das Porträt der Königin zeigten. Das mag den Übergang für sehr viele erleichtert haben. Ihr Gesicht steht somit auch für die Hinwendung zum europäischen Nachbarn: Am 1. Januar 1973 trat Großbritannien der Europäischen Union bei. Doch im Jahr 2014 stimmte das Volk mehrheitlich für den Austritt, verblendet durch skrupellose Demagogen, in die Irre geführt durch eine jahrzehntelange Fehlinformation der Murdoch-Presse. Elizabeth II. hatte 15 PremierministerInnen kommen und gehen sehen. Jetzt blieb sie stumm.
Und dies ist vielleicht die eine große Kritik, die man der Queen stellen muss: Jahrzehntelang war sie passiv, oft entgegen ihrer Überzeugung, oft auch gegen ihr besseres Wissen. Natürlich erlaubte ihr das parlamentarische System keine direkte Teilhabe an der Macht. Doch das Wort des Monarchen wiegt schwer, wenn es denn offen ausgesprochen wird. Die Pflicht des Königtums verlangt an sich auch, dass dieses Gewicht zum Wohle des Volkes in die Schale geworfen wird. Das hat Charles bereits als Kronprinz getan, für den Umweltschutz, den Erhalt der Artenvielfalt, für soziale Projekte und lebenswerte Städte. Elisabeth II. hingegen ließ den Brexit kommentarlos geschehen – ein Denkmal ihrer selbst. Ihre hochgelobte Unparteilichkeit könnte auf lange Sicht zum Totengräber der Krone werden.
Es bleibt, Ihre Bedeutung als Mensch zu würdigen. Ihr Leben lang blieb die Queen integer und persönlich ohne jeden Skandal. Ihre Kinder und Enkel mochten moralisch scheitern, sie selbst lebte die altenglischen Ideale von Pflichterfüllung, Zurückhaltung und Familienwerten. Sie war ohne Allüren, lebte innerhalb des geerbten Pomps der Paläste ein relativ normales Leben: Gerüchteweise bevorzugte sie Toast zum Frühstück und Aufgewärmtes aus der Tupperdose zum abendlichen Fernsehkrimi. Über 400 Termine im Jahr absolvierte sie mit eiserner Disziplin. Ihr Interesse an zahllosen Vereinen und karitativen Organisationen war genauso echt wie die Vorliebe für Rennpferde und ein gutes Glas Gin & Dubonnet. Berühmt ist ihr Sinn für Humor, angeblich verschenkte sie im engsten Familienkreis aus Prinzip nur billige Scherzartikel.
Was sind die Zukunftsaussichten der Monarchie? Ist mit „Elisabeth der Ewigen“ auch die Seele des Königtums gestorben? Nein, nochmals nein. Die Krone ist das Fundament des Vereinigten Königreiches. Selbst wenn Schottland mit einem neuen Referendum wieder zu einer unabhängigen Nation würde (und bislang war die Queen das wichtigste einigende Band), so änderte es nichts an der grundliegenden Tatsache: Elisabeth, eine 96-jährige Urgroßmutter, ist friedlich eingeschlafen, doch die Krone ist unsterblich, sie ist das Land und die Nation, der Quell von allem, was die Identität, die Eigenart und Kultur Großbritanniens ausmacht. Sie kann nicht sterben.
In diesem Sinne erhebe ich mein Glas auf das Andenken an Königin Elizabeth II. Sie war eine wahrhaft epochale Jahrhundertgestalt und ein großartiger Mensch. Gleichzeitig trinke ich auf das Wohl von König Charles III. Möge er lange und gut herrschen.